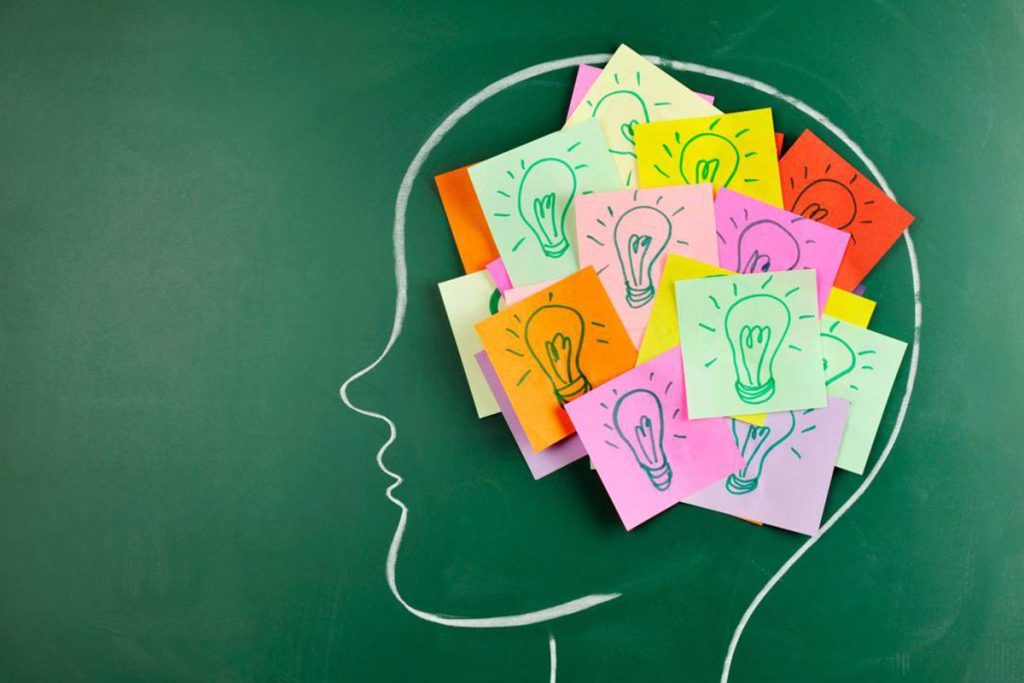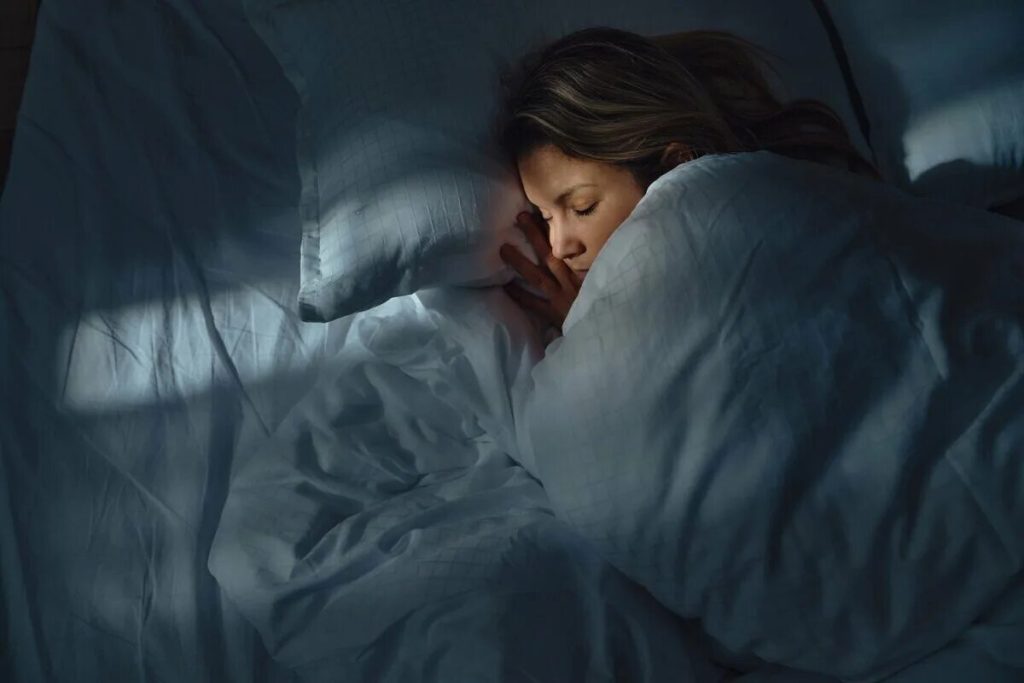Laut Psychologen kann ein solches Verhalten Menschen, die keine Grenzen setzen können und immer nachgeben, großen Schaden zufügen. Die gute Nachricht ist, dass sich dies ändern lässt, da es sich nicht um eine angeborene Eigenschaft handelt, sondern um eine erworbene.
In jeder Beziehung, sei es zwischen Partnern, Freunden oder Familienmitgliedern, hat die Art und Weise, wie wir kommunizieren, einen großen Einfluss auf die Qualität der Beziehungen. Allerdings drücken sich nicht alle Menschen auf die gleiche Weise aus. Die einen neigen dazu, ohne Filter zu sagen, was sie denken, andere vermeiden Konflikte um jeden Preis. Letztere, die lieber schweigen, um Konflikte zu vermeiden, bilden einen Persönlichkeitstyp, den die Psychologin sehr gut kennt. Deshalb erklärt sie uns, warum dieses Verhalten auftritt, welche Folgen es hat und vor allem, wie man es ändern kann.

Drei Kommunikationsstile: aggressiv, unterwürfig-passiv, durchsetzungsstark
„Es gibt drei grundlegende Kommunikationsstile“, erklärt sie. „Der erste ist aggressiv, er wird von Löwen repräsentiert, also Menschen, die Konflikte lieben und sagen, was sie denken. Der zweite ist passiv-unterwürfig, Mäuse, die schweigen oder das sagen, was sie glauben, dass ihr Gesprächspartner hören will. Und schließlich gibt es noch die assertiven Delfine, die niemanden angreifen und sich auch nicht angreifen lassen.“ In diesem Fall geht es um „Mäuse“, also um Menschen, die aus verschiedenen Gründen ihre Gefühle unterdrücken.
Warum manche Menschen lieber schweigen
Hinter dem Schweigen verbirgt sich Angst. „Viele Menschen haben Angst, ihre Gefühle zu zeigen, weil sie befürchten, abgelehnt oder verlassen zu werden. Sie glauben, dass sie nicht verlassen werden, wenn sie schweigen. Das ist eine unbewusste Strategie, um Beziehungen aufrechtzuerhalten, selbst auf Kosten des eigenen Wohlbefindens“, erklärt der Experte.
In anderen Fällen liegt die Ursache in der Kindheit. „Sie sind in einem Umfeld aufgewachsen, in dem es Geschrei, Trennungen und Gewalt gab … und haben gelernt, dass es besser ist, zu schweigen. Vielleicht liegt sogar eine generationsübergreifende Trauma vor, wenn unterwürfige Mütter oder Großmütter dieses Muster weitergegeben haben.“
Viele Menschen glauben, dass ein guter Mensch zu sein bedeutet, sich nicht zu beschweren, zu vergeben und zu ertragen. Aber nein, ein guter Mensch zu sein bedeutet nicht, sich ausnutzen zu lassen.
Manchmal lässt auch ein Mangel an Kommunikationsfähigkeiten beobachten. „Das sind Menschen, die nicht wissen, wie sie ein Thema ansprechen sollen, und das verursacht ihnen solche Angst, dass sie lieber schweigen.“ Auch „was andere sagen werden“ spielt eine Rolle: „Sie glauben, dass sie unhöflich oder arrogant wirken, wenn sie sagen, was sie denken … Diese einschränkenden Überzeugungen blockieren sie.“
Andererseits kann die falsche Vorstellung bestehen, dass ein „guter Mensch“ zu sein bedeutet, zu schweigen. „Viele Menschen glauben, dass ein guter Mensch zu sein bedeutet, sich nicht zu beschweren, zu vergeben und zu ertragen. Aber nein, ein guter Mensch zu sein bedeutet nicht, sich ausnutzen zu lassen. Manche glauben, dass sie egoistisch sind, wenn sie sagen, was sie denken, obwohl sie in Wirklichkeit nur ihre emotionale Gesundheit schützen.“
Hochsensible und ängstliche Menschen: diejenigen, die Konflikte am meisten vermeiden
Laut dem Experten gibt es Menschen, die besonders sensibel auf Konflikte reagieren, wie beispielsweise HSB (hochsensible Menschen). „Ihr Gehirn reagiert sehr stark auf Stress. Ich bin selbst eine von ihnen. Konflikte verursachen bei mir Anspannung, obwohl ich versuche, meine Gedanken in einer höflichen Form zu äußern.“ Studien, die beispielsweise an der Harvard University durchgeführt wurden, bestätigen, dass solche Menschen dazu neigen, Konflikte zu vermeiden.
„Das ist auch typisch für Menschen mit sozialer Angst, unbehandelten Angststörungen oder Bindungsangst, die sich emotional distanzieren, um sich zu schützen.“ Dies ist ein Abwehrmechanismus, der sowohl bei Männern als auch bei Frauen zu beobachten ist, wobei laut Experten Männer tendenziell eher zu Bindungsangst neigen.
Untersuchungen der Harvard University zeigen, dass hochsensible Menschen dazu neigen, Konflikte zu vermeiden, weil ihr Gehirn sehr stark auf Stress reagiert.
Erziehung von Kindheit an
Wie die Expertin erklärte, kann Schweigen eine Strategie sein, die von klein auf gelernt wurde. „Viele von ihnen stammen aus Familien mit emotionalen Tabus, in denen Probleme nicht angesprochen wurden. Oder sie hatten autoritäre oder abwesende Eltern. All das hat einen starken Einfluss.“ Die Psychologin erwähnt auch die „Verstärkung des Schweigens“: Wenn Schweigen Konflikte vermeidet, interpretiert das Gehirn dies als wirksame Strategie.
Kinder, deren Emotionen nicht bestätigt wurden, neigen ebenfalls zu diesem Verhalten. „Sätze wie „Sei still“, „Weine nicht“, „Das ist Mädchenkram“ oder „Du übertreibst“ lassen ein Kind denken, dass es schlecht ist, seine Gefühle zu zeigen.“
Es gibt noch einen weiteren sehr verbreiteten Typ: Kinder, die „von ihren Eltern erzogen“ wurden und sich um Eltern mit emotionalen Problemen kümmern mussten. „Anstatt Fürsorge zu erhalten, haben sie sie gegeben. Sie konnten ihre Gefühle nicht ausdrücken, weil sie für die Erwachsenen verfügbar sein mussten.“
Die Folgen übermäßiger Verschlossenheit
Unabhängig von den Ursachen hat systematische Verschlossenheit verheerende Folgen. „Erstens emotionale Anspannung. Alles, was man nicht ausspricht, bleibt im Inneren und bricht irgendwann hervor. Das kann zu Wutausbrüchen, Schlaflosigkeit, Angstzuständen führen …“
Außerdem kommt es zu einem Identitätsverlust. „Wenn man immer schweigt, gibt man auf, wer man ist. Man verliert seine eigene Persönlichkeit.“ Eine solche Unterdrückung von Emotionen kann zu Somatisierungen führen: „Muskelschmerzen, Verdauungsprobleme, psychosomatische Erkrankungen“.
Und das wirkt sich auf Beziehungen aus. „Sie werden unaufrichtig, instabil, sogar beleidigend. Menschen, die keine Grenzen setzen können, geraten in Beziehungen, in denen sie nur nachgeben und der andere das Sagen hat. Sie fühlen sich schuldig, gekränkt und ihr Selbstwertgefühl sinkt.“
Dieses Verhalten ist nicht angeboren, sondern erworben. Und es ist einer der häufigsten Gründe für die Inanspruchnahme eines Therapeuten. Mit kognitiver Verhaltenstherapie kann man daran arbeiten: indem man einschränkende Überzeugungen ändert, das Selbstwertgefühl steigert und die emotionale Intelligenz verbessert.
Das kann man ändern: Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Therapie
Die gute Nachricht laut der Psychologin ist, dass dieses Verhaltensmuster geändert werden kann. „Es ist nicht angeboren, sondern erworben. Und das ist einer der häufigsten Gründe, warum Menschen einen Therapeuten aufsuchen. Man kann daran mit Hilfe der kognitiven Verhaltenstherapie arbeiten: indem man einschränkende Überzeugungen ändert, das Selbstwertgefühl steigert und die emotionale Intelligenz verbessert.“
Der Psychologe glaubt fest an Assertivität. „Das ist Training. Man muss lernen, zu sagen, was man denkt, und Grenzen zu setzen. Ich bin eine begeisterte Anhängerin dieses Ansatzes. Selbstachtung beginnt mit der Fähigkeit, „Nein“ zu sagen. Und das kann man in wenigen Wochen lernen.“
Wie kann man jemandem helfen, der immer schweigt?
Menschen, die jemanden umgeben, der immer schweigt und nachgibt, können ihm ebenfalls helfen. Wie? Indem sie sichere Räume schaffen, in denen diese Person sprechen kann. Bestätigen Sie ihre Emotionen mit Sätzen wie „Ich verstehe dich“, stellen Sie offene Fragen, üben Sie keinen Druck aus. Sprechen Sie nicht für ihn, sondern begleiten Sie ihn in seinem Prozess. Und gehen Sie mit gutem Beispiel voran, indem Sie zeigen, wie man auf gesunde Weise Grenzen setzt. Unterstützen Sie jeden Fortschritt und seien Sie geduldig. Veränderungen brauchen Zeit.

Was kann man selbst tun
Es gibt mehrere Hilfsmittel, die dabei helfen, dieses Muster zu durchbrechen:
- Beginnen Sie eine Einzeltherapie.
- Üben Sie Selbstbeobachtung und achten Sie auf Ihre innere Sprache. Wenn sich beispielsweise jemand in der Schlange im Supermarkt vordrängelt, denken Sie nicht „Jetzt werde ich schon wieder gehänselt“, sondern sagen Sie sich: „Okay, ich werde nach und nach Grenzen setzen“ und sagen Sie: „Entschuldigung, bitte stellen Sie sich hinten an“.
- Lernen Sie, in kleinen Dingen „Nein“ zu sagen. Ersetzen Sie selbstkritische Sätze durch Sätze wie „Ich habe das Recht, meine Meinung zu sagen“.
- Verwenden Sie Techniken wie die „stuck record“ (festgefahrene Schallplatte): Wiederholen Sie dieselbe Botschaft, ohne sich zu rechtfertigen. Zum Beispiel: „Tut mir leid, ich kann dir mein Auto nicht leihen.“
- Nutzen Sie WhatsApp, um Zeit zu gewinnen. Wenn Sie jemand um etwas bittet, das Sie nicht geben können, z. B. um Geld, antworten Sie später mit einer klaren Nachricht: „Entschuldigung, das kann ich dir nicht geben.“ So vermeiden Sie, unter dem Druck des Augenblicks zuzustimmen.
- Dieser Kanal kann auch genutzt werden, um auszudrücken, was Sie nicht persönlich gesagt haben: „Hör mal, was du vor allen gesagt hast, hat mich verletzt. Bitte tu das nicht mehr.“
Sprechen ist sehr wichtig für das Selbstwertgefühl. Wenn Sie es nicht tun, haben Sie das Gefühl, dass man über Sie lacht.
Wenn sich jemand in der Schlange im Supermarkt vordrängelt, können Sie, anstatt zu denken „Jetzt werde ich wieder ausgenutzt“, sich sagen: „Okay, ich werde nach und nach Grenzen setzen“ und sagen: „Entschuldigung, die Schlange steht hinter Ihnen.“
Wann sollte man professionelle Hilfe in Anspruch nehmen?
Wenn Sie Angstzustände, Schlaflosigkeit oder körperliche Schmerzen ohne erkennbaren Grund verspüren. Wenn Sie sich von der Gesellschaft isolieren, um Konflikten aus dem Weg zu gehen. Wenn Sie sich selbst für das, was Sie sagen oder nicht sagen, verantwortlich machen. Wenn Sie in all Ihren Beziehungen immer wieder dasselbe Muster wiederholen und sich unsichtbar oder verletzt fühlen. Wenn Sie ungelöste Traumata oder unkontrollierbare Wutausbrüche haben. All dies sind Anzeichen dafür, dass Sie Hilfe brauchen.