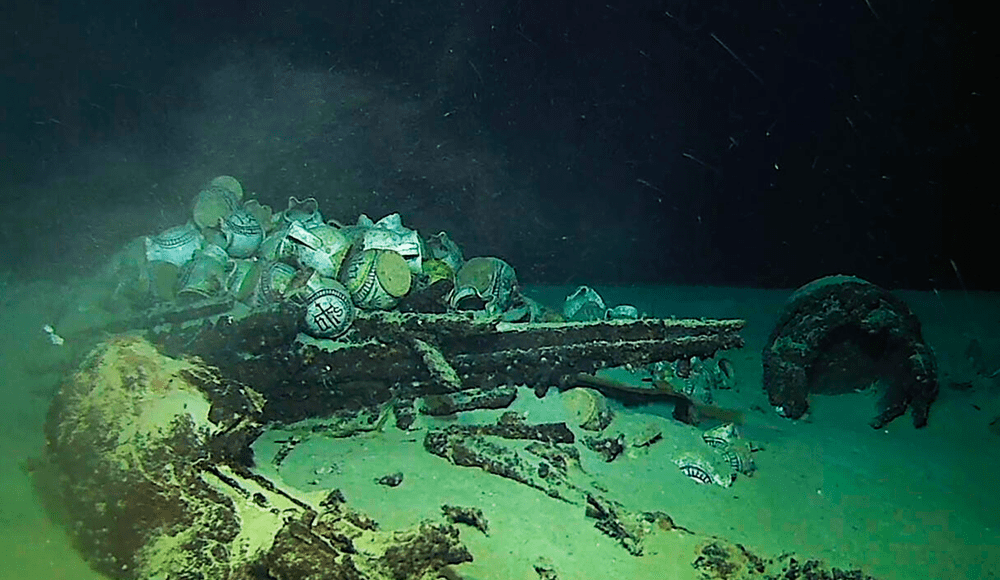Über 90 % der Wirkung unserer Botschaften hängt von nonverbalen Elementen ab. Selbst kleinste Bewegungen, wie das Berühren der Haare oder der Nase oder das Abwenden des Blicks während eines Gesprächs, können viel darüber aussagen, wie wir uns fühlen.

Was den Blick betrifft, so ist eine Bewegung, die Unbehagen verrät, das Vermeiden von Augenkontakt mit jemandem.
Die meiste Zeit sprechen wir, ohne uns dessen bewusst zu sein und ohne den Mund zu öffnen. Unsere Gesten, unsere Körperhaltung, unser Gesichtsausdruck, unsere Bewegungen, unser Blickkontakt und andere Elemente verraten uns oft und zeigen sogar unsere Emotionen und unsere Einstellung. Die nonverbale Sprache spielt eine wichtige Rolle in unseren Gesprächen, da sie das vermitteln kann, was wir mit Worten nicht ausdrücken können.
Laut einer Studie, die der Forscher und Psychologe Albert Mehrabian in den 60er Jahren durchgeführt hat, hängen mehr als 90 % der Wirkung unserer Botschaften von diesen nonverbalen Elementen ab. Der Psychologe hat den Einfluss der von uns übermittelten Botschaften in folgende Komponenten unterteilt: 7 % hängen mit verbalen Mitteln zusammen, 38 % mit der Stimme (Tonfall, Intonation…) und 55 % mit Gesten und Mimik. So wird die nonverbale Sprache zu einem Kommunikationsmittel, das Nervosität, Unbehagen oder Flirten ausdrücken kann, und die Kenntnis dieser Signale kann uns wichtige Hinweise darauf geben, was im Kopf unseres Gesprächspartners vorgeht.
Selbst kleinste Bewegungen, wie das Berühren der Haare oder der Nase oder das Abwenden des Blicks während eines Gesprächs, können viel darüber aussagen, wie andere Menschen sich fühlen, wenn sie mit uns sprechen, und so können wir unsere Sprache anpassen. Auch wenn sie nicht immer universell sind, können die Gesamtheit der Signale und der Kontext Hinweise für die Kommunikation mit jemandem geben.
Der Blick ist im sozialen Bereich von großer Bedeutung. Den Blick vermeiden oder wegschauen „bedeutet in der Regel, dass wir etwas verbergen wollen, dass wir uns unsicher fühlen oder das Gefühl haben, uns vor etwas schützen zu müssen“, erklärt der Psychologe. In vielen Fällen besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem, wohin wir schauen, und dem, was wir vermitteln wollen, da die Richtung unseres Blicks den Teil unseres Gehirns aktiviert, der für das Gedächtnis oder die Kreativität zuständig ist.
Was den Blick betrifft, so ist die Bewegung, die Unbehagen verrät, das Vermeiden von Blickkontakt mit jemandem; das ist die „Absicht, sich abzuschalten“, verrät sie, und wenn „der Blick nicht gehalten wird, steckt dahinter meist eine unangenehme Emotion“, fügt sie hinzu.
Auch Hand- und Fußbewegungen oder die Körperhaltung sagen viel über uns aus: „Der Körper neigt dazu, sich zu bewegen, wenn wir angespannt sind, zum Beispiel schnell mit dem Fuß zu wippen. Diese motorische Unruhe kann uns auch helfen, unsere Angst zu regulieren und uns in diesem Moment zu entspannen“, erklärt die Psychologin.
Häufige Haltungswechsel sind ebenfalls ein Alarmsignal: „Wenn wir uns unwohl fühlen, fällt es uns schwerer, eine bequeme Position zu finden, und wir bewegen uns mehr“, sagt die Psychologin. Darüber hinaus wird das Berühren von Gegenständen wie Ringen, Stiften oder Ärmeln „als Selbstregulierungsverhalten definiert, das uns helfen kann, wenn wir sehr nervös sind, aber im Moment der Kommunikation mit jemandem unser Unbehagen oder unsere Nervosität zeigt“. Sich zusammenziehen, kleiner machen, zusammenkauern oder nach vorne beugen – auch das sind Selbstschutzreaktionen.

Warum reagiert unser Körper so?
Nonverbale Kommunikation ist die älteste und instinktivste Form der Interaktion, die es gibt, weshalb „sie am schwierigsten bewusst zu kontrollieren ist; unser Körper offenbart unsere Gefühle oft früher als Worte“, sagt Tena, die diese Art der Sprache als „primäres Kommunikationssystem“ definiert, „da der Körper automatischer reagiert als das Gehirn“.
Aus neurobiologischer Sicht „ist der Körper ein Spiegel unseres Nervensystems. Wenn wir uns unwohl fühlen, gerät unser Körper in einen Zustand erhöhter physiologischer Aktivität, der sich in unwillkürlichen körperlichen Signalen äußert“, erklärt die Psychologin. Das autonome Nervensystem ist in zwei Bereiche unterteilt: den sympathischen und den parasympathischen.
Das parasympathische System wird aktiviert, wenn wir uns entspannen müssen, und das sympathische System in Situationen der Aktivierung, wenn wir uns bewegen müssen. Letzteres wird auch in Situationen von Unbehagen oder Bedrohung aktiviert, selbst wenn es sich nicht um eine physische Verletzung handelt, und verursacht Herzrasen, vermehrtes Schwitzen, beschleunigte Atmung und Muskelverspannungen: „Wenn sich ein Mensch unwohl fühlt, wird dieses System aktiviert, das uns auf eine mögliche Flucht oder Ausweichreaktion vorbereitet, auch wenn wir nicht so weit kommen, aber weil wir uns unwohl fühlen, wollen wir es tun“, sagt sie.
Auf sozialer Ebene „hängt das Gefühl des Unbehagens weitgehend mit einer sozialen Bedrohung zusammen, die zwar nicht physischer Natur ist, aber die Angst vor Verurteilung, Ablehnung oder Konflikt beinhaltet. Diese soziale Bedrohung aktiviert dieselben Bereiche des Gehirns wie physischer Schmerz. So empfinden wir Unbehagen sehr physisch und real, und der Körper beginnt, es zu zeigen, um uns zu regulieren.“