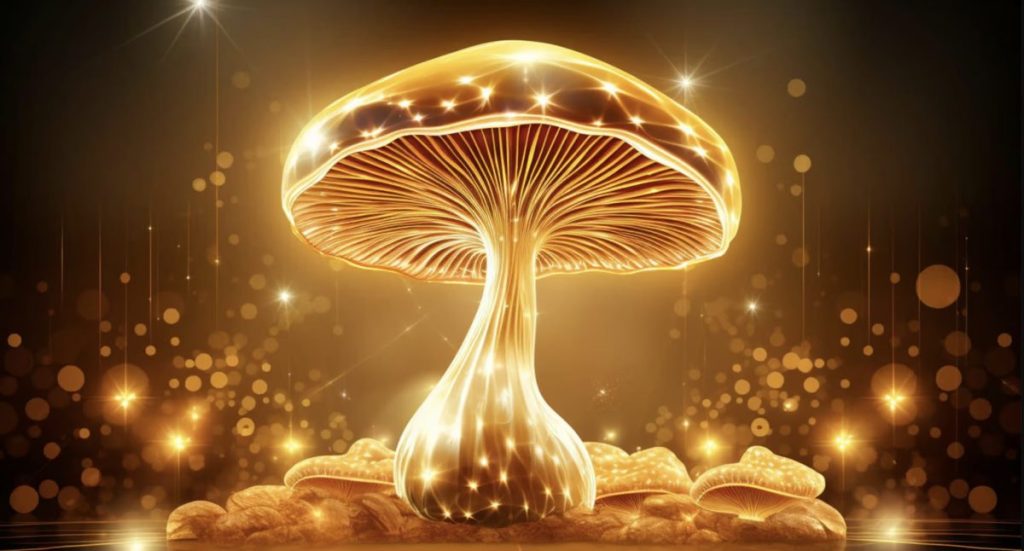Gold ist aufgrund seiner chemischen und physikalischen Eigenschaften eines der am besten untersuchten und wertvollsten Metalle. Seine Korrosionsbeständigkeit und thermische Stabilität spielen eine wichtige Rolle in verschiedenen Bereichen, von der Schmuckherstellung bis hin zu Spitzentechnologien. Über Jahrhunderte hinweg galten diese Eigenschaften als fester Bestandteil der physikalischen Realität. Ein kürzlich durchgeführtes Experiment mit Gold hat jedoch alle Vorstellungen auf den Kopf gestellt.

Dank neuerer Errungenschaften im Bereich ultraschneller Erhitzungsmethoden und atomarer Messungen konnten Forscher bisher unerreichbare Szenarien untersuchen. Diese Experimente haben Raum für Unsicherheiten hinsichtlich grundlegender Konzepte wie dem Schmelzpunkt geschaffen.
So verlief das Experiment mit Gold, das die Vorstellungen von den physikalischen Grenzen verändert hat
Eine internationale Gruppe von Wissenschaftlern verwendete einen ultrakurzen Impulslaser, um 50 Nanometer dicke Goldfragmente zu erhitzen. Unter normalen Bedingungen schmilzt dieses Metall bei 1064 Grad Celsius.
Im Laufe des Experiments wurden jedoch Temperaturen von fast 18.700 Grad Celsius erreicht, ohne dass die feste Struktur sofort zerfiel. Diese Entdeckungen wurden bereits in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht.
Dieses Phänomen wird als Überhitzung oder Superheizung bezeichnet. Es besteht nicht nur darin, dass der Schmelzpunkt überschritten wird, sondern auch darin, dass dies so schnell geschieht, dass die Atome keine Zeit haben, sich in einen flüssigen Zustand umzugliedern. In diesem Fall behielt Gold seine feste Struktur für mehr als zwei Pikosekunden bei, was auf atomarer Ebene eine beträchtliche Zeit ist.
Die Erwärmungsgeschwindigkeit überstieg 6 × 10¹⁵ Kelvin pro Sekunde, was alle bisherigen Versuche deutlich übertrifft. Bei dieser Geschwindigkeit sammelt sich die Wärme an, bevor die Atome reagieren können, wodurch eine Wärmeausdehnung und die Zerstörung des Kristallgitters verhindert werden.
Die Entropie-Katastrophentheorie
Seit 1988 ist in der Materialphysik das Konzept der Entropie-Katastrophe anerkannt, wonach ein Festkörper die dreifache Höhe seiner Schmelztemperatur nicht überschreiten kann, ohne zu schmelzen.
Dieses von Fechte und Johnson vorgeschlagene Modell geht davon aus, dass bei Erreichen eines bestimmten Punktes die Unordnung in einem festen Körper der Unordnung in einem flüssigen Körper entspricht, was seine Stabilität unmöglich macht.
Die Ergebnisse des Experiments mit Gold widerlegen diese Idee. Den Daten zufolge blieb das Metall bei Temperaturen, die deutlich über den theoretisch vorhergesagten lagen, fest.
Der Schlüssel zur Lösung des Rätsels liegt offenbar darin, dass bei extrem schneller Erhitzung die Entropie eines festen Körpers vor Abschluss des Übergangs nicht das Niveau einer Flüssigkeit erreicht. Auf diese Weise wird der von der klassischen Theorie vorhergesagte thermodynamische Kollaps verhindert.

Wie wurde die extreme Temperatur gemessen?
Der Erfolg des Experiments hing von der Fähigkeit ab, extrem hohe Temperaturen in sehr kurzer Zeit zu messen.
Die Forscher verwendeten die Methode der inelastischen Streuung von Röntgenstrahlen in einer Rückstreukonfiguration. Diese Methode ermöglicht es, die Geschwindigkeitsverteilung der Ionen direkt zu beobachten, indem sie die Schwingungen der atomaren Struktur bei der Energieaufnahme widerspiegelt.
Jeder Laserimpuls erzeugte ballistische Elektronen, die die Wärme sofort an Wärmeelektronen und diese wiederum an Ionen des Kristallgitters weitergaben. Durch die Analyse der spektralen Breite der Röntgenstrahlen konnte die erreichte Temperatur genau bestimmt werden, ohne auf indirekte Modelle zurückgreifen zu müssen.
Die Messungen bestätigten, dass das für festes Gold charakteristische Beugungssignal bis zu 19.000 Kelvin erhalten blieb und erst nach zwei bis drei Pikosekunden verschwand. Dies war ein Beweis dafür, dass Gold in einem Temperaturbereich fest blieb, der in der traditionellen Physik als unmöglich galt.
Folgen und mögliche Anwendungen dieses Experiments mit Gold
Die Autoren der Studie vermuten, dass einige Materialien unter extrem schnellen Erhitzungsbedingungen keinen festen Schmelzpunkt haben könnten. In diesem Fall wäre der übliche Wert eher eine Folge der zeitlichen Dimension des Experiments als eine interne Eigenschaft.
Diese Möglichkeit wirft Fragen zum Verhalten fester Körper unter extremen Bedingungen auf, wie beispielsweise im Inneren von Planeten, bei Asteroideneinschlägen oder bei nuklearen Explosionen.
Das Verständnis dieser Prozesse könnte wichtige Erkenntnisse für die Astrophysik, die Plasmaphysik und die Entwicklung neuer widerstandsfähiger Materialien liefern.
Es bleibt zu klären, ob dieses Phänomen nur bei Gold auftritt oder auch bei anderen Elementen reproduziert werden kann. Sollte es sich bei anderen Materialien bestätigen, müsste das derzeitige theoretische Modell zur Stabilität fester Körper grundlegend überarbeitet werden.
Was ändert sich für die Materialwissenschaft?
Das Experiment mit Gold widerlegt nicht nur eine seit mehr als drei Jahrzehnten bestehende theoretische Grenze, sondern führt auch einen experimentellen Ansatz ein, der die Grundlagen der Materialphysik neu denken könnte.
Wenn Wärme schneller übertragen wird, als ein Stoff reagieren kann, gelten die bekannten Regeln nicht mehr.
Die Kombination aus ultraschnellen Lasern und hochpräzisen Röntgenstrahlungsquellen spielte bei diesem Durchbruch eine entscheidende Rolle. Mit der Weiterentwicklung dieser Technologien wird es möglich sein, längere Experimente mit einem höheren Maß an Kontrolle und an einem breiteren Spektrum von Materialien durchzuführen.
Derzeit eröffnet diese Entdeckung neue Wege für die Erforschung der Stabilität fester Körper und ihrer Hitzebeständigkeit – ein Bereich, der in den kommenden Jahrzehnten sowohl die Theorie als auch die Praxis der Materialwissenschaften revolutionieren könnte.